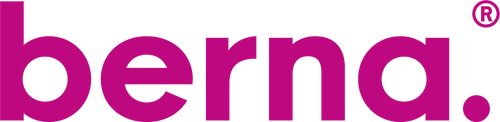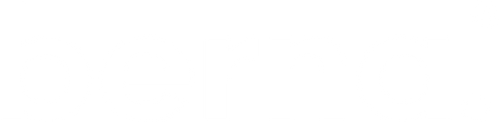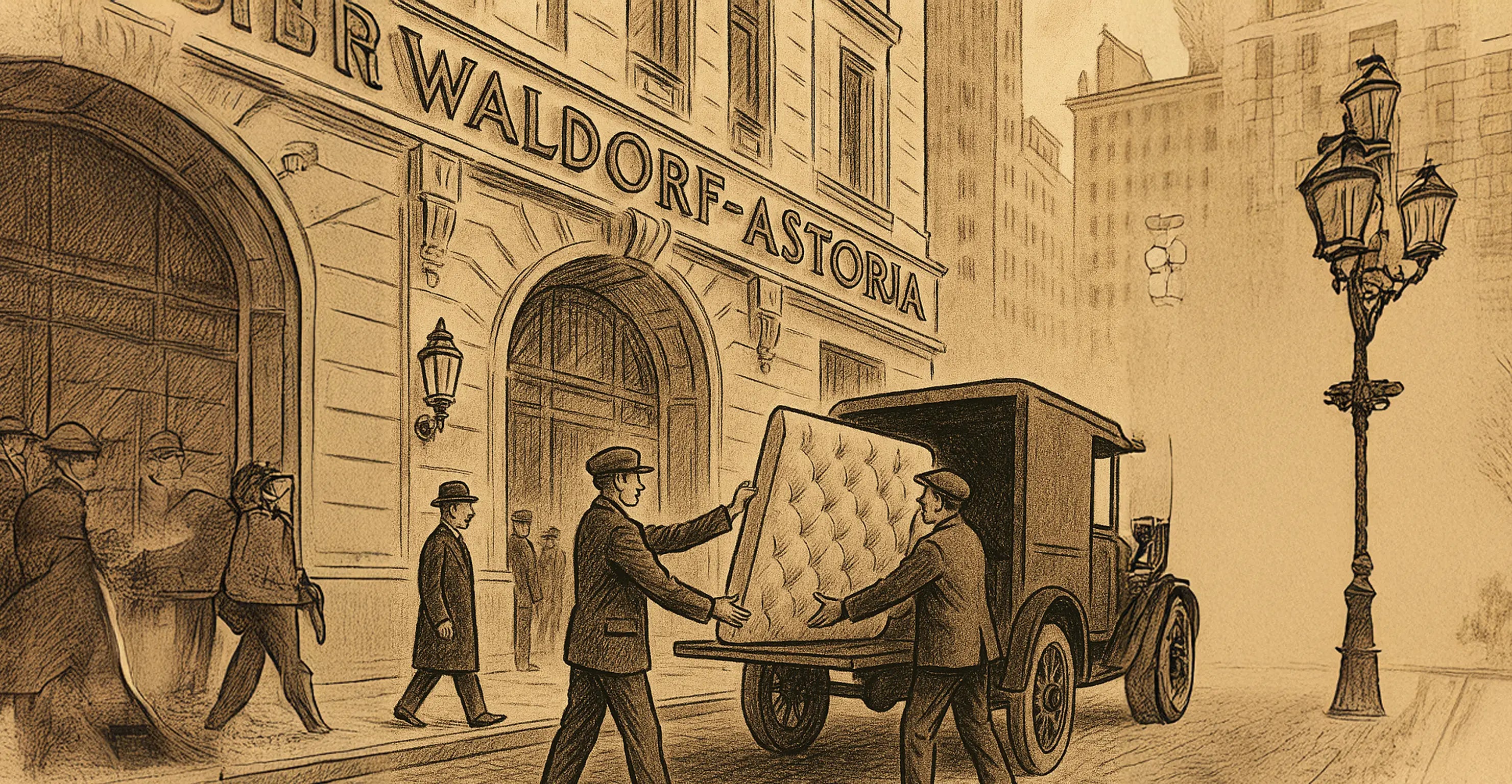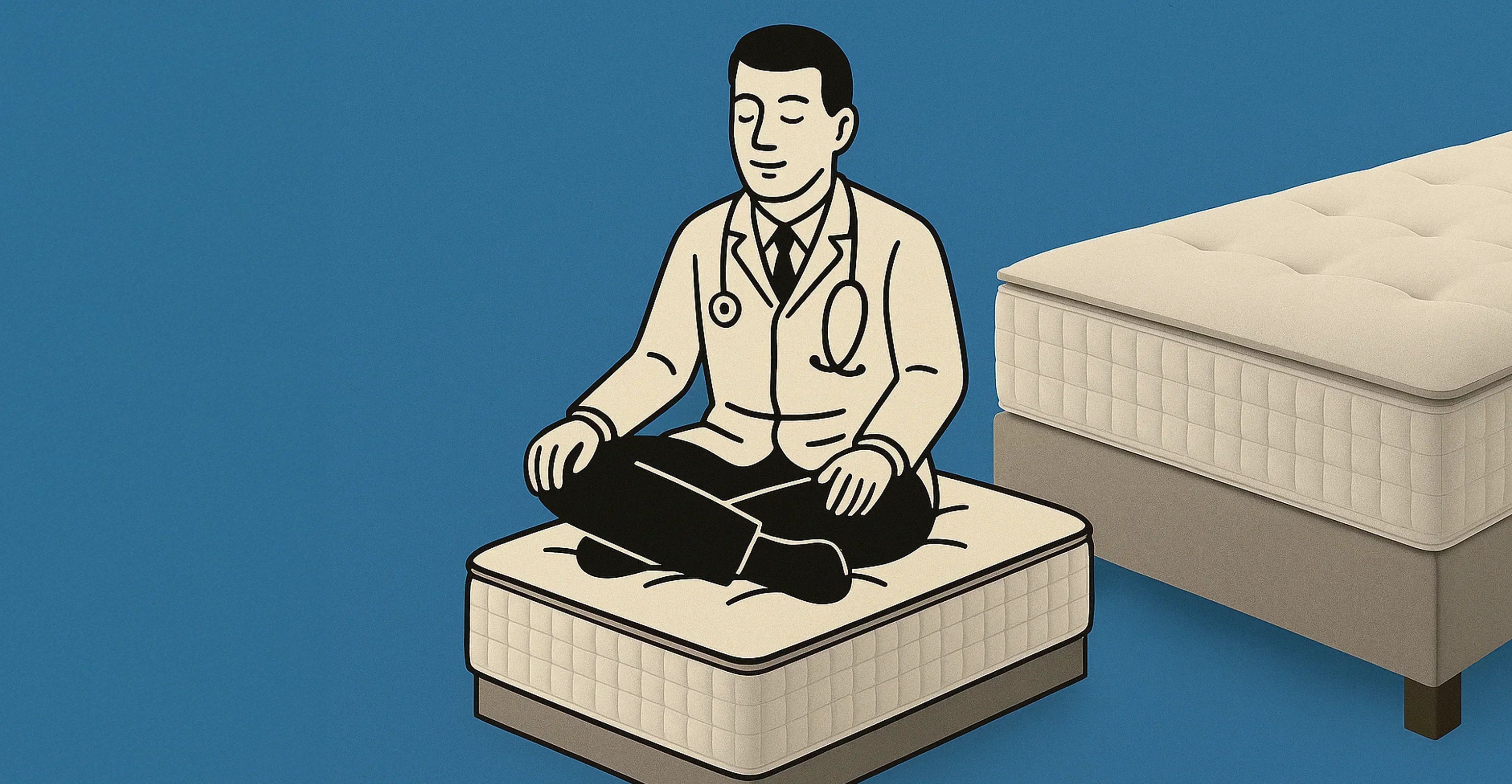Von berna
Man könnte sagen, die Geschichte des Boxspringbetts beginnt mit einer Lüge. Nicht der bösen Sorte, sondern der höflichen – jener, die man sich selbst erzählt, um besser zu schlafen. Amerikaner sind gut darin. Sie sagen, sie hätten das weiche Bett erfunden, so wie sie den Cocktail, den Cheeseburger und den Jazz erfunden haben. In Wahrheit aber, und das ist der hübscheste Teil der Legende, erfand es niemand. Es passierte einfach, irgendwann zwischen dem zweiten Martini und dem dritten Jahrhundert der Erschöpfung.
Ich kam auf die Idee, darüber zu schreiben, als ich eines Nachts in einem Hotelbett lag, das so hart war, dass es wahrscheinlich schon den Bürgerkrieg gesehen hatte. Das Zimmer roch nach Chlor und nach etwas, das vorgab, Zedernholz zu sein. Ich dachte: Wenn das der Fortschritt ist, möchte ich die Vergangenheit kennenlernen. Und so begann meine kleine Recherche über die weichste Revolution, die die Menschheit je erlebt hat.

In den Archiven der Hotellerie fand ich kaum mehr als ein paar Skizzen, ein Patent aus von 1873, ein paar Werbeanzeigen mit glücklichen Ehepaaren, die aussahen, als hätten sie nie geschwitzt. Doch dann, irgendwo zwischen den vergilbten Seiten, tauchten immer wieder dieselben Worte auf: grand comfort. Und das, so begriff ich irgendwann, war kein technischer Begriff – es war ein Sehnsuchtsausdruck.
Vor dem Boxspringbett, erzählten mir Historiker, war Schlaf eine Sache für Stoiker. Die Betten waren hart, die Decken dünn, die Nächte lang. Man lag, man litt, man hoffte auf den Morgen. Erst als die Hotels wuchsen – jene Kathedralen des Bürgertums, in denen alles glänzte außer der Moral – begann man, über Schlaf als Erlebnis nachzudenken. Der Gast sollte nicht einfach ruhen, er sollte vergessen.

Ich sprach mit einem alten Polsterer, der schwor, sein Großvater habe im Waldorf-Astoria gearbeitet, „damals, als sie noch dachten, das Bett müsse die Haltung verbessern“. Irgendwann, erzählte er, habe ein gewisser Charles – oder vielleicht hieß er anders – bemerkt, dass die Betten seiner besten Kunden nachgaben, weil die alten Holzrahmen gebrochen waren. Und diese Gäste seien glücklicher abgereist als die anderen. So habe man beschlossen, das Prinzip zu systematisieren. Ein Bett, das nachgibt, verkauft sich besser als eines, das belehrt.
Von da an ging es schnell. Amerika war bereit für eine Religion, die man liegen konnte. In den Fünfzigern wurde das Boxspringbett zum Symbol des neuen Lebensstils – großzügig, bequem, moralisch neutral. Man konnte darin schlafen, lesen, streiten, lieben. Ein Möbel für alles, was das Sofa nicht wissen durfte. Europa, wie immer skeptisch gegenüber allem, was angenehm war, brauchte noch ein paar Jahrzehnte. Erst die Skandinavier machten daraus eine Philosophie. Sie nahmen dem amerikanischen Überfluss den Speckrand ab, ließen die Schlichtheit übrig und nannten es Design.

Heute, in Paderborn, wo man Betten noch baut, statt sie zu lagern, treffe ich Menschen, die glauben, das Boxspringbett sei wieder eine moralische Frage. Sie sprechen von Handwerk, von Nachhaltigkeit, von Schlaf als Kulturtechnik. Ich sehe ihnen zu, wie sie Federn setzen, Stoffe spannen, Holzrahmen verschrauben, und denke, Truman Capote hätte seine Freude gehabt: All diese Sorgfalt für einen Ort, an dem niemand zusieht. Aber vielleicht liegt genau darin der Reiz. Das Boxspringbett ist die demokratischste Form des Luxus: Jeder hat es sich verdient. Es predigt keine Lehre, es verspricht nur Nachsicht. Und wenn man lange genug darauf liegt, vergisst man sogar, dass es eine Erfindung war. Man glaubt, es hätte immer existiert – so selbstverständlich wie die Nacht selbst.

Anmerkung des Autors: Manche Erfindungen verändern die Welt, andere nur die Nacht. Das Boxspringbett gehört zu Letzteren – und vielleicht ist das sein größter Triumph. Denn was wäre Fortschritt, wenn er nicht wenigstens einmal am Tag nachgibt.
Text berna / Illustrationen ChatGPT